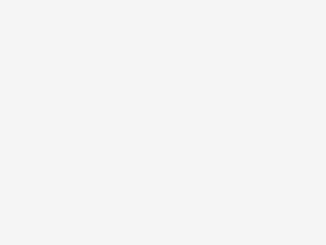Der Kreis hat sich geschlossen. Das wollte Dream Theater wohl auch mit ihrem Programm am Donnerstag auf dem Bonner Kunst!Rasen ausdrücken. Das Programm beginnt mit der instrumentalen „False Awakening Suite“ aus dem letzten unbetitelten Album der New Yorker Prog-Metal-Band, und mit der Zugabe „Behind the Veil“ schließt es, ebenfalls aus diesem Album, auf dem Drummer Mike Mangini erstmals am gruppendynamischen Kreativprozess beteiligt war. Für die Band spielt es eine doch große Rolle, dass sie sich nach dem Ausstieg des für sein übermächtiges Ego berüchtigten früheren Schlagzeugers Mike Portnoy 2010 vom Druck befreite und ein Werk vorlegte, das dennoch weiterhin in der Dream Theater-Tradition Bestand hatte.

Die Band ist auf ihrer 30th Anniversary Tour, Grund genug also, einmal Fazit zu ziehen. Dabei stimmt es eigentlich nicht so ganz mit dem 30. Geburtstag. Denn als die drei Musikstudenten John Petrucci (Gitarre), John Myung (E-Bass) und Mike Portnoy 1985 die Band gründeten, nannten sie sich noch Majesty, mussten den Namen aber bald aufgeben. Sie behielten indes bis heute ihr damals entwickeltes Logo: das große M in einem Peace-Kreis.
30 Jahre Bandgeschichte – das schreit eben nach einem Programm, das diesen runden Geburtstag würdigt. Und so fügte die Band am Donnerstag jeweils ein Stück aus jedem ihrer Studioalben in diesen musikalischen Lebenskreis. Mit „Afterlife“ brachte sie dann auch eines der schwermetalligen Stücke aus ihrem offiziellen Debütalbum „When Dream and Day Unite“ aus dem Jahr 1989 zu Gehör. (Weitere Artikel und Interviews: DT in Köln, Bonn, James LaBrie-Interview)

Wenn man sich die Bandgeschichte in diesem musikalischen Zeitraffer anhört, dann wird sehr schnell deutlich, worum es der Band immer ging: den Progressive Rock, der Ende der 1980er Jahre praktisch dem Niedergang entgegenfloss, wiederzubeleben, aber so, dass er sich stilistisch den vielen Verästelungen des Rock öffnet. Metallica meets Yes und Genesis, und Rush bildet die ultimative Klammer. So ungefähr könnte man es wohl ausdrücken. Denn da wurden fettes Rockvokabular mit filigraner Virtuosität und intelligentes Songwriting verschmolzen.
Der Kanadier James LaBrie, mit dessen Gesang sich manche schwer tun, hat als ausgebildeter Opernsänger sicherlich Maßstäbe gesetzt. Obwohl er am Donnerstag wohl eher kränkelte, was man bei den ersten Stücken durchaus merkte, gab der 52-jährige eher ernste Sänger eine beeindruckende Vorstellung seines Stimmumfangs ab – auch wenn er immer wieder hinter die Bühne gehen musste, um mit seinem Geheimrezept, heißes Wasser mit etwas Honig, seine Stimmbänder zu ölen.
Insgesamt muss man aber dennoch feststellen, dass dies eine der schwächeren Vorstellungen war, die die Truppe abgab. Vielleicht lag es tatsächlich an einem kränkelnden LBrie, vielleicht aber auch daran, dass auch irgendwie der Sound nicht stimmte – und das bei einem Kollektiv, das so viel Wert auf gute Klangqualität legt: Es war insgesamt streckenweise viel zu leise, relativ dumpf abgemischt und wirkte irgendwie gedrosselt.
Gitarrist John Petrucci und Keyboarder Jordan Rudess bewiesen zwar nach wie vor wieder einmal, dass sie sich geradezu blind verstehen. Diese atemberaubenden Linien, die wahnwitzigen Tempi- und Harmoniewechsel, die sie teilweise parallel spielten, das Zuwerfen solistischer Bälle, das glänzende Feeling für Dramatik und Spannung, war schon ein wahrer Genuss. Dennoch wirkte manche Vorstellung etwas blutleer. Herausheben muss man auf jeden Fall John Myung, der übrigens seit dem Weggang von Portnoy immer mehr aus sich herausgeht und an seinem sechssaitigen Bass ausnehmende Akzente setzte. Glänzend: sein Bassintro zu „Panic Attack“.
Auch über Mike Mangini, den Professor an den Drums, kann nichts Schlechtes geschrieben werden. Der Mann ist eine beeindruckende Schlagwerkmaschine, der technisch einfach nur zum Staunen ist.
Mit exakten 90 Minuten Spielzeit wirkte das Konzert aber eher wie eine Zwischenmahlzeit – bei einer Band, die sonst nie unter zweieinhalb Stunden von der Bühne ging.

Davor schon wirkten Haken und Devon Townsend Project wie eiligst zwischengeschobene Vorbands. Die eigendlich fantastische Londoner Progrock-Band Haken (Interview) spielte gerade einmal eine halbe Stunde, darunter aber wenigstens das Epos „Cockroach King“, das schon sehr an Gentle Giant erinnerte. Aber das Sextett um Sänger Ross Jennings wollte in dieser halben Stunde wohl ihre stilistische Vielfalt demonstrieren, erreichte aber gerade bei dem Publikum, das es noch nicht kannte, eher etwas Verwirrung. Dennoch insgesamt ein guter Auftritt, der auf jeden Fall nach mehr schreit.
Devon Townsend (Interview deutsch / english) entschied sich für ein gemischtes Programm aus seinem Schaffenswerk, stieg ein mit „Rejoice“ aus dem zweiten Teil seiner Fantasygeschichte „Zeltoid“ und machte weiter mit „Namaste“ aus dem Album „Physist“ (2000), das durchaus orchestral begann, aber dann schon fast in Speed Metal überging. Mit „Grace“ gab es einen Einblick in die bombastische Seele des manchmal schon fast angsteinflößenden Masterminds, der über eine prächtige Bühnenpräsenz verfügt. Überhaupt gab Townsend eine faszinierende Vorstellung – nicht nur an der Gitarre, sondern auch mit seinem Wechsel zwischen klaren Gesangspassagen, Growling, Screaming, Shouting und auch durchaus operettenhaften Gesängen („Kingdom“).
Fazit: Es hätte von allem gerne etwas mehr sein dürfen.
(Cem Akalin)