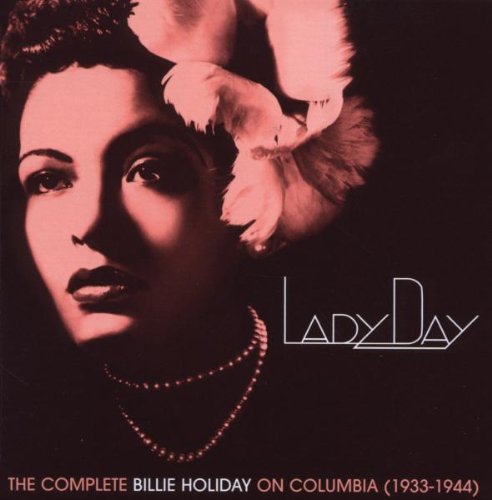
“If I’m going to sing like someone else,
then I don’t need to sing at all.”
Billie Holiday
Von Cem Akalin
Man musste sie nur anschauen, wenn Lester Young sein Solo auf dem Tenorsaxophon spielte, dann wusste man Bescheid. Lester und Billie Holiday waren füreinander geschaffen. „Rein platonisch“, sei ihre Beziehung gewesen, betonte Billie Holiday stets. Völlig egal. Aber wenn sie gemeinsam Musik machten, dann existierte nichts mehr außer ihrer Musik. Die beiden hatten diese verletzliche Seele, sie hatten Dinge erlebt, die andere Menschen entweder brechen oder ihre Herzen zäh wie Leder werden lässt. Bei Lester und Billie war es anders. Das Leben, das war die Glasur, die sich auf ihren Sound legte. Keiner hatte einen sensibleren Ausdruck am Tenor als Lester, niemand vor oder nach Billie Holiday konnte mit jedem Ton seiner Stimme überzeugender über Liebe, Verlust, Schmerz und Hingabe singen als sie. „Everytime I do singin’, it’s part of my life”, sagte sie einmal. Vor genau hundert Jahren wurde Billie Holiday geboren.
„Sie war dreizehn an diesem Mittwoch, dem 7. April 1915, als ich zur Welt kam“, diktierte sie William Dufty für ihre Autobiografie „Lady Sings the Blues“ in den Block. Dass ihre Mutter bei ihrer Geburt gerade mal 13, ihr Vater 15 Jahre alt waren, stimmte genauso wenig wie so manche andere Darstellung. „Mit sechzehn war ich eine Frau. Ich war groß für mein Alter, hatte große Brüste, schwere Knochen, alles in allem eine große, fette und gesunde Braut. So fing ich an zu arbeiten, vor und nach der Schule: Babysitting, Botengänge erledigen und in ganz Baltimore diese verdammten weißen Treppen schrubben. (…) Alice Dean hatte damals ein Bordell an der Ecke unserer Nachbarschaft, und ich erledigte Botengänge für sie und die Mädchen.“ Und ihre Mutter habe es gar nicht gern gesehen, dass sie dort war.
Naja. Ein wenig Beschönigen darf schon sein bei all dem Bodensatz des Lebens, der sie umgeben hatte. Sarah „Sadie“ Fagan, wie ihre Mutter hieß, hatte selbst in dem Bordell gearbeitet. Und ihre Tochter, Eleonore Harris, die damals noch den Mädchennamen ihrer Mutter trug, wurde den Freiern gar mit ihrer Mutter gemeinsam für fünf Dollar angeboten. Da war sie nicht mal 14 Jahre alt. Das Einzige, was an der Geschichte wohl stimmte, war, dass es ihr als junges Mädchen ein Grammophon angetan hatte, das im Salon des Bordells stand und auf dem sie Louis Armstrong und Bessie Smith hörte.
Eleonore, das sei ihr zu lang gewesen, erzählt sie später. Sie hatte als Mädchen von einem der großen Filmstars im Hollywood geschwärmt. „Ich glaube nicht, dass ich einen einzigen Film von Billie Dove verpasst habe. Ich war geradezu verrückt nach ihr und versuchte, meine Haare genauso zu frisieren. Schließlich habe ich ihren Namen übernommen“, erzählt sie in ihrem Buch.
Der Nachname stammt von ihrem vermeintlichen Vater, einem Jazzgitarristen namens Clarence Holiday. John Hammond, der bekannte Plattenproduzent und Entdecker von Leuten wie George Benson, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Aretha Franklin und vielen anderen mehr, erzählte einmal, wie er Billie Holiday das erste Mal live erlebte. Es war ihr erster kurzer Auftritt im Apollo in New York. Als er wenig später Clarence Holiday in einem Club traf, soll er ihn angeraunzt haben: „Clarence, wieso hast du mir nie von deiner Tochter erzählt? Sie ist die größte Sängerin, die ich je gehört habe.“ Dieser soll ihn in eine Ecke gewunken und gesagt haben: „Um Gottes willen, John! Sprich nie wieder vor meinen Freunden von meiner Tochter. Die denken sonst, ich sei alt. Sie ist doch nur etwas, was ich mit 14 gestohlen habe.“ Tatsächlich war ihr biologischer Vater ein gewisser Frank DeViese.
Geboren in Philadelphia, wuchs Billie aber mehr bei der älteren Halbschwester ihrer Mutter Eva Miller in Baltimore auf. Mit elf Jahren von einem Nachbarn vergewaltigt, danach ein Jahr in einem katholischen Erziehungsheim, mit 13 Prostituierte, mit 14 kam sie zunächst in den Knast, dann in ein Arbeitshaus. Danach beginnt sie in Clubs in Harlem zu singen.
 Es gibt ein wunderbares Dokument. Ein Interview von Dave Dexter Jr., das er 1939 mit Billie Holiday geführt hat, in dem sie eigentlich erklären will, warum sie nie wieder in einem Tanzorchester wie denen von Artie Shaw oder Count Basie singen will. Sie erzählt zwar, wie die Bandleader ihr den Erfolg neideten, dass sie sie um ihre Gage betrogen und sie kaum noch auftreten ließen, wie sie durch die Hintertüren der Clubs gehen musste, nur den Lastenaufzug benutzen durfte und in irgendwelchen Abstellkammern auf ihren Auftritt warten musste. Aber sie kommt auch ins Plaudern, erzählt, wie sie mit zehn Jahren, völlig ausgehungert, in einem Club singt. Der Pianist stimmt “Body and Soul” an. “Jeez, you should have seen those people—all of them started crying”, erzählt sie dem Musikkritiker des DownBeat. Sie sei mit 18 Dollar Trinkgeld nach Hause zu ihrer Mutter gegangen. „So fing das damals alles an.“
Es gibt ein wunderbares Dokument. Ein Interview von Dave Dexter Jr., das er 1939 mit Billie Holiday geführt hat, in dem sie eigentlich erklären will, warum sie nie wieder in einem Tanzorchester wie denen von Artie Shaw oder Count Basie singen will. Sie erzählt zwar, wie die Bandleader ihr den Erfolg neideten, dass sie sie um ihre Gage betrogen und sie kaum noch auftreten ließen, wie sie durch die Hintertüren der Clubs gehen musste, nur den Lastenaufzug benutzen durfte und in irgendwelchen Abstellkammern auf ihren Auftritt warten musste. Aber sie kommt auch ins Plaudern, erzählt, wie sie mit zehn Jahren, völlig ausgehungert, in einem Club singt. Der Pianist stimmt “Body and Soul” an. “Jeez, you should have seen those people—all of them started crying”, erzählt sie dem Musikkritiker des DownBeat. Sie sei mit 18 Dollar Trinkgeld nach Hause zu ihrer Mutter gegangen. „So fing das damals alles an.“
Der Musikkritiker lässt sich nicht einwickeln. Es gebe da eine Aufnahme mit Benny Goodman, sagte er, wohl ihre erste Tonaufnahme, und sie klinge darauf geradezu lausig. „Ich war erst 15“, antwortet sie empört. „Und ich hatte eine Höllenangst.“
Gottseidank hört Dexter immer noch nicht auf, obwohl er, wie er bemerkt, genug Stoff für eine Story hat. Und er fragt sie, wie sie das mit dem Singen mache. „Ich glaube nicht, dass ich singe“, erklärt sie. „Ich habe das Gefühl, als würde ich ein Horn spielen. Ich versuche zu improvisieren wie Les Young, wie Louie Armstrong, oder sonsteiner, den ich bewundere. Was aus mir herauskommt, ist, was ich fühle. Ich hasse es, geradeaus zu singen. Ich muss das Stück zu meinem eigenen machen. Das ist alles, was ich weiß.”
Sie hat nicht das, was man eine großartige Stimme nennt. Sie hat nicht einmal einen großen Stimmumfang, aber es ist diese Art der Phrasierung, dieses „shaping“, diesen Ausdehnen und Formen bestimmter Töne, dieses ganz leicht hinter dem Orchester her schlendern, die Freiheit, die sie sich nimmt, aus jedem Stück ihr eigenes zu machen. Das ist es wohl auch, was nach ihr so viele Sängerinnen und Sänger, ja Generationen von Jazz-Musikern als Vorbild nahmen. Dennoch: Billie Holiday bleibt Billie Holiday. Es ist diese Spannkraft und Biegsamkeit in ihrer Stimme, dieses Flanieren in ihren Gesten, was ihr Publikum sofort bezaubert. Und eben dieser sanfte Belag auf der Stimme, dieser abgenutzte Lack auf dem geschmeidigen Klang, der ihr ganzes Leben wiedergibt.
„Man hat mir gesagt, dass niemand das Wort ‚Hunger‘ so singt wie ich. Genauso das Wort ‚Liebe‘. Vielleicht liegt das daran, dass ich weiß, was diese Worte bedeuten. (…) Alles was ich je von den Menschen gelernt habe, liegt in diesen beiden Worten.“
Das Bemerkenswerte an dem Interview ist indes ihre Einschätzung ihrer Zukunft. Immerhin galt sie 1939 als äußerst erfolgreich mit gut 150 Dollar Verdienst pro Woche. Doch sie machte sich offenbar nichts vor: Sie erwarte, dass ihre Zukunft ebenso unspektakulär und unprofitabel verlaufen werde, vertraute sie Dexter an.
Billie und Lester trafen sich auf einer Harlem Jam-Session in den frühen 30er Jahren und arbeiteten in der Count Basie Band und in Nachtclubs an New Yorks 52. Straße. Lester verbrachte viel Zeit bei Billie und ihrer Mutter. Angeblich war Lester ein großer Fan von der Hausmannskost ihrer Mutter und froh, mal den rattenverseuchten New York Hotelzimmern zu entkommen. „Er war nur ein Teil der Familie. Es war eine angenehme Abwechslung, einen Herrn im Haus zu haben, und Lester war immer ein Gentleman“, erzählte Billie. Sie seien eben sehr gute Freunde gewesen. Sie war es, die Lester den Spitznamen „Prez“ gab, nach Präsident Franklin D. Roosevelt sei er der „größte Mann“. Lester wiederum gab Billie ihren berühmten Spitznamen „Lady Day“.
Am 15. März 1959 starb Lester Young an Herzversagen in New York – wohl eine Folge seiner Drogen- und Alkoholsucht. Als seine Frau ihr untersagte, auf seiner Beerdigung zu singen, erlitt sie einen Zusammenbruch. „Those motherfuckers won’t let me sing for Prez”, soll sie Freunden geklagt haben. Und: “Ich werde die Nächste sein.” Sie sollte Recht behalten. Vier Monate später, am 17. Juli, starb auch sie. Für ihr Begräbnis hatte sie wohlweislich vorgesorgt. Während auf ihrem Konto nur noch wenige Cent lagen, fand man nach ihrem Tod in der Klinik fünfzig 50-Dollar-Scheine, versteckt in einem Strumpf.
Info:

Anlässlich Ihres 100. Geburtstags zeigt ARTE am 12. April 2015, um 22.05 Uhr, die Dokumentation „Billie Holiday – A Sensation“ und im Anschluss (23 Uhr) das Konzert von Cassandra Wilson, die Billie Holidays Musik neu interpretiert.



