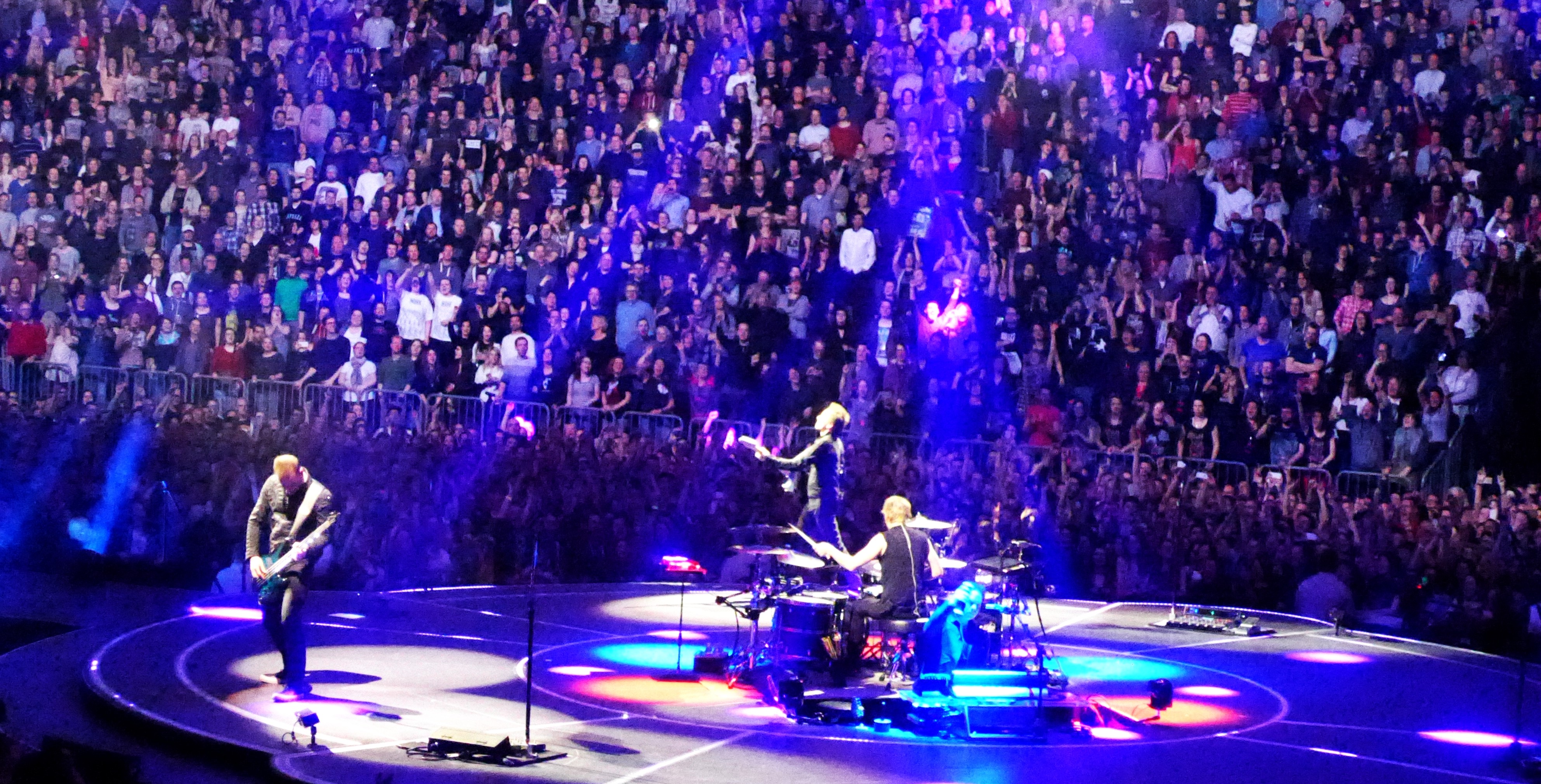Das Gespräch mit Efrat Alony, die am 12. Mai auf dem Jazzfest Bonn zu hören ist, beginnen wir mit einem älterem Album, „Dismantling Dreams“ (2009), das viel über die musikalischen Wurzeln der israelischstämmigen Jazzsängerin aussagt. Über ihre Geschichten, die sehr konkrete Hintergründe haben, aber auch aus einer Märchenwelt stammen können und Liedern, die auch mal „hässlich“ klingen sollen, sprach Efrat Alony mit Cem Akalin.
Efrat Alony, „Dismantling Dreams“ (2009) beginnt mit seinem Titelstück so beeindruckend, dass man erst mal befürchtet, Sie hauen da stimmlich alles raus, was in Ihnen steckt. Die Bandbreite liegt locker zwischen Ricky Lee Jones, Joni Mitchell und Billie Holiday. Wo sehen Sie sich selbst?
Efrat Alony: (lacht) Gute Frage! Joni Mitchell ist eine große Inspiration für mich. Billie Holiday habe ich erst später begonnen zu lieben. Und von Ricky Lee Jones gibt es ein Album, das ich großartig finde: „Pop Pop“. Aber ich versuche, beim Singen nicht an andere Klangfarben zu denken. Es geht mir wirklich darum, die Geschichte in dem Lied zu erzählen, und dann sind alle Mittel recht. Dazu gehört, auch mal ganz hässlich zu klingen oder komische Sounds zu kreieren.
Und bei „Dismantling Dreams“?
Alony: Da geht es ja darum, wie Träume zerfallen. Da war mir ein weicher, fragiler Klang wichtig.
Texte sind also wichtig für Sie?
Alony. Extrem!
Die Texte sind so poetisch wie rätselhaft, da kommen Chöre aus Licht vor, vergangene Gedanken des Tages tanzen durch die Nacht, blaues Mondlicht lässt Sie zu Kristall erstarren… Sind Sie eine surreale Märchenerzählerin?
Alony: Ich mag es, mich auf der Grenze von sehr Direktem und sehr Abstraktem zu bewegen, so dass die Dinge vielfältig interpretierbar sind. Es gibt einen sehr schönen Spruch von Diane Arbus…
Die Fotografin. Lou Reed hat sie sehr verehrt!
Alony: Genau! Sie hat viele Fotoreportagen gemacht. Und sie sagte: „Je mehr du ins Detail gehst, desto allgemeingültiger wird es.“ Je genauer man in der abstrakten Vorstellung ist, desto einfacher ist es für Leute, sich darin zurechtzufinden. Es geht mir darum, Menschen zu eigenen Reflektionen zu bringen, Abstand zu sich zu bekommen und Dinge ihres Lebens zu hinterfragen.
Ihre Kompositionen haben die Vielschichtigkeit von Träumen, ohne eindeutige Grenzen und teilweise, im positiven Sinne, so verloren, als bewegte man sich in einem Wunderland, wo immer wieder neue Landschaften und Türen auftauchen. Woher kommt diese so völlig andere Musiksphäre?
Alony: Ja, das kommt aus den assoziativen Gedanken – eben wie in einem Traum. Und dieser assoziative Fluss kommt natürlich aus dem Jazz. Bei der Improvisation entscheidest du dich auch immer wieder, wohin du gehen willst und du weißt zunächst nicht, wo es enden wird. Das ist genau das, was ich extrem spannend finde.
Von Grenzen halten Sie nichts, oder?
Alony: Nein! (lacht)
Lässt sich das biografisch erklären?
Alony: Ich bin ein wenig ein Trotzkind. Wenn man mir sagt, dass ich etwas nicht darf, dann tu ich es gerade. Das gibt es in meinem Leben natürlich viel. Etwa auch bei der Frauenrolle. Das fängt bei profanen Dingen wie Kochen an. Ich bin eine Frau, aber muss ich deswegen kochen können? Nein! Ich entspreche jedenfalls nicht dem Bild einer Sängerin. Ich mag es nicht, in Rollen gedrängt zu werden. Ich finde es spannender, Grenzen zu schieben.
Deshalb gibt es auch kein festes Genre, in das Sie passen?
Alony: Das hat tatsächlich mit meiner Biografie zu tun. Ich bin ja nicht mit Jazz aufgewachsen. Ich bin erst beim Studium in Israel bewusst damit in Berührung gekommen. Ich finde mich deshalb keinen Genres, wenn es die denn geben muss, verpflichtet. Ich weiß, dass das viele irritiert. Es ist aber eine große Freiheit.
Und wenn Sie noch hebräisch singen, dann wirkt das, zumindest für westliche Ohren, noch rätselhafter. „Shir“ (auf „a kit for mending thoughts“ 2012) ist eine Interpretation eines Stückes von Etti Ankri. Worum geht’s da? Warum dieses Stück?
Alony: Etti Ankri hat mich als 16-, 17-Jährige sehr berührt, weil sie auch eine dunkle, selbstbewusste Art des Singens hatte. Sie strahlte eine unfassbare Stärke aus.
Sie hat sich später auch dem orthodoxen Judentum zugewandt.
Alony: Richtig! Sie ist unheimlich religiös geworden. Damit kann ich aber weniger anfangen. In „Shir“ geht es darum, das absolute, das schöne Lied überhaupt zu finden, um im Inneren in Flammen aufzugehen.
Die Stücke, die Sie auf Hebräisch singen, wirken, wie in der Ferne geboren, wie ausgegraben und zu neuem Leben erweckt.
Alony: Das trifft es sehr gut. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich mich im Hebräischen Zuhause fühle. Es ist meine Muttersprache. Ich bin erst mit 21 Jahren von Israel weg. Wenn ich das hebräische Wort für „Mutter“ ausspreche, dann habe ich tausend Bilder im Kopf, weil ich eben sehr viele Lebenssituationen mit dieser Sprache verbinde. Was du da hörst, ist diese unbewusste Ebene der Musik, die aus meinem tiefsten Inneren kommt.
Die Lieder haben eine leichte Schwermut, die indes nicht depressiv, sondern eher verspielt wirkt.
Alony: Schwermut steht in Deutschland für diese Melancholie, für mich ist es eine Klangästhetik, die man sehr häufig in der israelischen Musik findet und die mich sehr reizt. Irgendjemand hat mal gesagt: Alle glücklichen Familien sehen gleich aus, traurige sehen immer anders aus.
Das Ganze hat trotz des sehr sparsamen Arrangements eine Dynamik. Dass ich mir das sehr gut als Tanztheater vorstellen kann. Schon mal über sowas nachgedacht?
Alony: (lacht) Das ist tatsächlich mein nächster Plan. Ich versuche gerade mit einem israelischen Fotografen ein Stück auf die Beine zu stellen mit Texten von einem sehr wichtigen israelischen Dichter. Yehuda Amichai ist in Würzburg geboren, emigrierte aber nach Israel. Und es gibt Texte von ihm, die dieses Thema Emigration, neue Sprachfindung thematisiert. Das würden wir gerne umsetzen, suchen aber noch nach Sponsoren.
Mit dem wunderbaren Frank Wingold an der Gitarre, dem Sie viel Raum geben, bekommt das Ganze eine gewisse Schärfe, Wildheit. Was ist zwischen diesen beiden Alben passiert?
Alony: (lacht) Genau das! Ich dachte: „Dismantling Dreams“ ist wunderschön geworden, ich brauche ein bisschen mehr Ätsch!
Das alles klingt tatsächlich noch etwas schräger, bekommt mehr Kante, vielleicht sogar eine gewisse Abstraktion. Warum?
Alony: Auf jeden Fall! Aber die Struktur der Songs ist ähnlich. Ich finde auch, dass es in meinen fünf Alben einen roten Faden gibt, aber die Klangfarbe hat sich geändert. Es ist eigentlich nur eine veränderte Geschenkpackung.
Es ist schon mehr!
Alony: Wenn du das so empfindest, akzeptiere ich es. Aber für mich ist es eine logische Weiterentwicklung. Ein Freund sagte mir: Wenn man „A Kit for Mending Thoughts“ für sich alleine höre, dann würde man einen ganz anderen Eindruck gewinnen, als wenn man das Album nach den anderen hörte. Dann würde es Sinn machen. Für mich ist es eine Timeline.