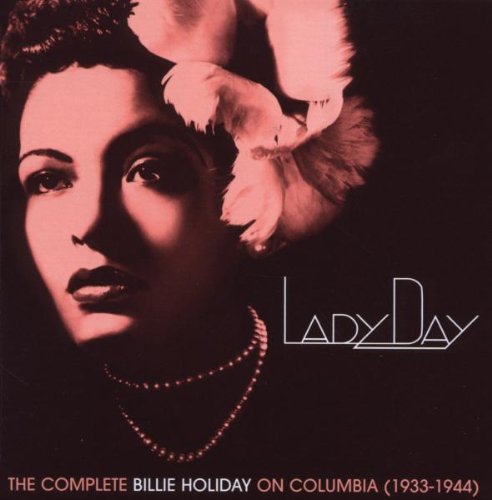Von Cem Akalin
Den Haag. Seit dem Tod der legendären Blues-Sängerin Billie Holiday ist die Jazz-Szene auf der Suche nach einer ebenbürtigen Nachfolgerin. Aber noch nie war diese Suche nach der weiblichen Jazzstimme so intensiv wie zur Zeit. Der aktuelle Trend der Rückbesinnung auf alte Traditionen läßt auch die Jazz-Sängerinnen wieder in den Vordergrund rücken. Das 21. North Sea Jazz Festival in Den Haag brachte vor allem die Frauen ins Rampenlicht. Betty Carter, die schon vor fast fünfzig Jahren als Sängerin der Lionel Hampton Big Band die Säle zum Swingen brachte, riß das Publikum mit ihrem musikalischen Feuer mit.
Oleta Adams, die vor wenigen Jahren in einem kleinen Jazz Club in Kansas City von den beiden Tears for Fears-Sängern Curt Smith und Roland Orzabal entdeckt wurde, erinnerte mit einer Gospeleinlage daran, wo ihre Wurzeln liegen: „Ich habe in der Kirche angefangen zu singen, und ich singe auch heute nicht für den Ruhm, sondern für Gott.“ In den USA schon frenetisch gefeiert, haben sich jetzt Rachelle Ferrell und Nnenna Freelon auch in Europa einem breiten Publikum vorgestellt. Ferrell, die schon mit Popsongs erfolgreich war, nahm vor fünf Jahren ihre erste Jazz-CD auf, die jedoch anfänglich nur in Japan vertrieben wurde ihr fehlte wohl der Mut für den heimischen Markt. Die Sorge war unbegründet: Kaum in Amerika angeboten, schaffte die CD auf Anhieb den Sprung in die Jazz-Charts. Und auch in Den Haag konnte Ferrell mit ihren ruhigen Swingstücken und einer samtigen Stimme schnell ihr Publikum erobern.
Mit einfühlsamen Balladen und flotten Swingnummern wurden auch Dianne Reeves und Cassandra Wilson den hohen Erwartungen der Zuhörer gerecht. Das North Sea Jazz Festival läßt noch einen weiteren Trend erkennen: die bittere Erkenntnis, daß die Dinosaurier des Jazz immer seltener werden. Die „alten Tiger“, um einen von Dave Brubeck geprägten Ausdruck zu verwenden, fehlten. Miles Davis, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Gerry Mulligan und andere kommen nur noch in Form von Zitaten vor.
Zu den wenigen „Tigern“ gehörte der 75jährige Clark Terry. Er spielte beim „Gipfeltreffen“ der Trompeter zusammen mit Nicolas Payton und Roy Hargrove, die beide erst Anfang zwanzig sind. Oskar Petersons Auftritt war bis zur letzten Minute unsicher. Schon bei seiner letztjährigen Deutschland-Tournee hatte er aus gesundheitlichen Gründen einige Konzerte ausfallen lassen müssen. Doch nun präsentierte sich der Swing-Pianist wieder von seiner bekannten klaren, lyrischen Seite. Sein vor einigen Jahren nach dem Tod seines Sohnes komponiertes Stück „He was Gone“ widmete er der kürzlich verstorbenen Jazz-Ikone Ella Fitzgerald. Begleitet wurde er von dem schwedischen Bassisten Niels-Henning Orsted Pedersen und dem Schlagzeuger Martin Drew. Gitarrist Lorne Lofsky lieferte sich mit dem Meister hinreißende musikalische Duelle.
Bei dem Konzert des Saxophonisten Wayne Shorter wäre Miles sicherlich gerne dabei gewesen. Es wäre so ganz nach seinem Geschmack gewesen. Nach seiner so ruhigen und durchkomponierten CD „High Life“ verblüffte der 63jährige Shorter mit einem Gig voller schwindelerregender Soli. Nicht nur verzichtete er auf Bläser- und Streichersätze, die Stücke wurden sehr viel aggressiver und freier präsentiert. Mit dem Bassisten Alphonso Johnson und dem Schlagzeuger Rodney Holmes hatte er eine kräftig vorwärtstreibende Rhythmuscombo, und David Gilmore ist als Gitarrist einfach unglaublich. Der Auftritt entschädigte für den enttäuschenden Festivalauftakt George Bensons, der kaum zur Gitarre griff und dem Publikum seine altbekannten Schnulzen auftischte.
So riesig das Programm des North Sea Jazz Festivals mit seinen mehr als 180 Bands und Auftritten auch ist leider versucht es jedes Jahr seine Superlative zu sprengen. Kamen im vergangenen Jahr schon weit mehr als 60 000 Besucher, so freut sich der Veranstalter diesmal, diese Zahl noch bei weitem zu übertreffen zum Nachteil des Besuchers. Denn viele der insgesamt 13 Musik-Foren waren hoffnungslos überfüllt. Um die Tageskarten möglichst gut auszunutzen, „surften“ viele von Konzert zu Konzert. So verkommt die Veranstaltung leider zu einem Fast-Food-Jazz-Festival, bei dem man sich an jeder Ecke mal schnell ein Häppchen „reinzieht“.