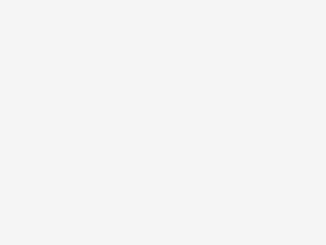Von Dylan C. Akalin
Natürlich hat man sofort die Assoziation Nick Cave im Kopf. Schon nach den ersten Tönen, die A.S. Fanning mit seiner tiefen, eindringlichen Stimme singt. Noch dazu diese düstere Stimmung, die sparsame Instrumentierung, diese Schatten, die sich bei jeder Zeile auf die Seele legen, wenn der Mann mit dem abgetragenen grauen Sakko und der Akustikgitarre um den Hals seinen Bariton anstimmt. Ungerührt. Der Gesang kommt aus tiefer Brust und trifft dich genau da. Tief in der Brust. Und wenn am Ende die Gitarre mit schrägen, kreischenden Sounds die scheinbare Gleichförmigkeit aufreißt wie eine verkrustete Wunde, dann kommen einem fast die Tränen. Im Genuss des Schmerzes.
A.S. Fanning, dieser hochgewachsene, schlaksige Ire, der seit elf Jahren in Berlin lebt, weil es ihm in Dublin zu eng geworden war, wie er später erzählt, ist jetzt schon die Entdeckung dieser Crossroads-Ausgabe, die der WDR Rockpalast seit Mittwoch wieder in der Harmonie Bonn präsentiert.

Und auch der Sound ist einfach sensationell. Als pünktlich um 19.15 Uhr die holzigen Rhythmen den Raum füllen wie in einer finsteren, feuchten Tropfsteinhöhle, die Keyboards nur unterschwellige Flächen beisteuern und dieser unerwartete Bariton erklingt, ist man sofort gefesselt von der Band und diesem Künstler, der gar nicht erst den Versuch unternimmt, sich mit Fröhlichkeit anzubiedern, sondern gleich seine miese Laune und seine Niedergeschlagenheit mit uns teilt. Er fühlt sich schlecht, egal ob er mitten in einer Menschenmenge steht, mit seiner Liebsten tanzt oder einfach in seinem eigenen Gehirn feststeckt: „I’m not trying to make a show/I’m not saying it for its own sake/I just thought you’d like to know that I feel bad.“
Damit wäre die Situation also klar. Da müssen wir jetzt alle durch. Doch das, was Fanning und seine Band uns gut 75 Minuten lang bietet, ist ein erlebnisreiches Konzert, fast ein Naturschauspiel, wie er da auf der Bühne steht, wie ein steinalter Baum mitten in einer menschenleeren Steppe, dem keine Stürme, keine Hitze oder Kälte zuzusetzen scheinen. Wenn er mit einer offenbar bedürfnislosen Gelassenheit diese eindringlichen Texte über das Ende der Zivilisation, über Liebe, Freundschaft, Tod und die Finanzkrise singt und um ihn herum seine Mitmusiker mit ihren Instrumenten Naturgewalten entstehen lassen, herrscht eine Spannung im Saal, die kaum intensiver sein könnte. Bei „Conman“ treiben Leadgitarrist Bernardo Sousa und Keyboarder David Adams ihre Instrumente mit gurgelnden, stotternden Sounds um den ruhigen Gesang. Es kratzt, schleift, brennt und jault ganz gehörig, als nähme der Sturm jedes Metall in seinen Wirbel auf.
„Mushroom Cloud“
Bei „Mushroom Cloud“ wiederum lässt die Band mit dem beachtenswerten Bass von Felix Buchner und den stets effektiven Drums von Francis Broek eine Stimmung entstehen, als würde die Musik von metallisch flirrenden Traumfängern ausgehen. Der Song mit einer düsteren Poesie, die wirklich Nick Cave gefallen würde, handele vom Ende der menschlichen Zivilisation, sagt Fanning, was merkwürdigerweise einige Lacher und Beifallsbekundungen erzeugt. „I like that reactions“, sagt Fanning trocken. Der Künstler schafft hier vielmehr eine morbide Endzeitszene, in der indes Liebe möglich scheint. Es sind die letzten Gedanken und Gefühle eines dem Tod Geweihten, dessen letzter Wunsch es ist, mit seiner Liebsten im blassgrünen Licht zu tanzen und ihr in die Augen zu blicken. Das sind diese Momente heiß-kalter Schauer, die Fanning mit seiner Band erzeugt.

Selbst wenn ein Song tanzbar ist wie „Haunted“, zu dem Francis Broek diese wunderschönen, knalligen Drums spielt, bleibt Fanning der Nachdenkliche. In diesem Lied beschäftigt er sich mit den Gedanken des Gegenwartstheoretikers Mark Fisher, dessen Werke er zu dieser Zeit viel gelesen habe, erklärt er einmal in einem Interview. Es geht um die „langsame Aufhebung der Zukunft“, um die irgendwie stets präsente kulturelle Vergangenheit, die eine unabhängige Referenz neuer Utopien und in die Zukunft gerichtete Ideen ersticke. „Ich habe darüber auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel nachgedacht und mit der sehr realen Aussicht, dass die Zukunft im Sinne einer Art gesellschaftlichen Zusammenbruchs zunichte gemacht wird. Dies droht uns jetzt in einer Weise, die es sehr schwierig macht, uns die Zukunft vorzustellen oder zu planen, was ein lähmendes Gefühl sein kann“, sagt Fanning. Wir tanzen also zu Zeilen wie „Fear is multiplying/The weight of meaning starts receding/ reaching, screaming The Weight of Meaning, anti-meaning, thought receding…“ Es ist einfach nur der Wahnsinn, was an diesem Abend geschieht. Neben Cave, tauchen auch Leonard Cohen, Depeche Mode, The National und David Bowie aus unserem Assoziationsrepertoire auf.
„Song to the Moon“
Marimba ähnliche Percussions erklingen bei „Disease“, Bass und Keyboards halten ein festes instrumentales Haus zusammen, in das die Gitarre immer wieder hineinsägt. Folkanklänge und starkes Singer/Songwritertum prägen „Carmelita“ und „Song to the Moon“, ein ganz ungewöhnlicher, stark verzerrter Basssound lässt „Worms“ ganz ungewöhnlich klingen. In „You Should Go Mad“ geht es um Geisteskrankheiten, wie Fanning sagt, ein Song, in dem die rhythmische Orgel eine besondere Rolle einnimmt. Mit Abbas „The Winner Takes It All“ beschließt die Band den Song „Abandoned“, ein Stück über die Bankenkrise. Und dann kommt mit „All Time“ das letzte Stück des regulären Sets, bei dem ich sofort annehme, es handele sich um ein Cover von Neil Youngs „Harvest Moon“, doch die Zeilen klingen völlig anders. Ein ganz toller Song, der wirklich wie eine Fannings’sche Bearbeitung des Young-Stücks klingt. „Nein“, sagt Fanning nach dem Konzert im Gespräch. „Aber durchaus möglich, dass da im Unterbewusstsein etwas mitschwang. Denn ich liebe Neil Young.“
Zur Zugabe gibt es „That’s Where They’ll Find You“ mit einem wunderschönen bluesigen Pianointro und die New Orleans-Referenz „Louis Armstrong“.
LÜT
Als zweite Band hören wir die norwegische Band LÜT. Bei der Power, Energie und Punkrockattitüde hätte man eigentlich einen Moshpit erwartet, der indes ausblieb. Die Band aus dem norwegischen Norden strotzt vor Kraft und sorgt gleich mit ihrer Mischung aus einfachen Melodien, treibenden Drums und wilden Gitarrenparts im Indie-Rock-Stil für tolle Stimmung im Saal. Dennoch: Die Gedanken bleiben bei A.S. Fanning.