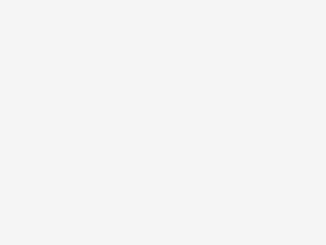Wer ist Till Brönner? Jazz-Trompeter, Sänger, Arrangeur, Komponist, Produzent und schließlich Jury-Mitglied der Casting-Show X Factor? 40 Jahre alt, aufgewachsen in Wachtberg, Abitur auf der Jesuitenschule Aloisiuskolleg in Bad Godesberg, im Alter von 20 bereits Mitglied der renommierten Berliner RIAS Big Band, Professor an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, vierfacher Echo-Gewinner, mit mehr als einer Million verkaufter Tonträger erfolgreichster deutscher Jazzmusiker aller Zeiten. Das Musiktalent wird früh von Horst Jankowski, Jiggs Whigham und Peter Herbolzheimer gefördert. Er spielt mit Jazzgrößen wie Natalie Cole, Tony Bennett, Ray Brown, Johnny Griffin, Ernie Watts, Dave Brubeck. Er spielt aber auch für Bootsy Collins und Snoop Doggy Dog, Mark Murphy und Rosenstolz. Er produziert die No Angels, Hildegard Knef und Manfred Krug. Er spielt Jazz, geht Verbindungen mit HipHop und elektronischer Musik ein. Sein jüngstes Album „At The End Of The Day“ ist mehr Pop als Jazz, teilweise sogar mit Country-Anklängen. Was davon ist also Till Brönner?
Die Zuschauer erleben ihn im Fernsehen bei „X Factor“ als einen, der sich verletzbar zeigt, fair im Umgang mit den Kandidaten, sehr darauf bedacht, niemandem weh zu tun. In schwachen Momenten zeigt er sogar so etwas wie Gereiztheit, wenn Mit-Jurorin Sarah Connor ihn und seine Künstler besonders niedermacht. Das kann er nicht ab. Selbst wenn die blonde Pop-Sängerin unter die Gürtellinie geht mit ihren Äußerungen, bleibt er der Gentleman. Höflich, nett, sympathisch. Einmal, da denkt man, da hofft man, dass er ausflippt. Aber er tut’s nicht. Er hat sich unter Kontrolle.
Höflich, nett, sympathisch. Nicht gerade Eigenschaften, die ein Jazzer gerne hört. Und so inszeniert er sich auch nicht. Es gibt diese wunderschönen Fotos von Ed Thrasher aus den sechziger Jahren. Dem ganz großen Fotografen, der bei der Gestaltung von Plattencovern Maßstäbe gesetzt hat. Diese elegante Lässigkeit eines Dean Martin, die scheinbare Spontaneität in der Haltung eines Frank Sinatra. Cool. Relaxt. Und alles hat diese beiläufige Exklusivität. Daran erinnert das Cover seiner CD „Rio“. Da hat Brönner sein Horn auf dem linken Bein aufgestellt, der Arm ruht lässig darauf. Er sitzt auf einem Hocker, aber er scheint auf dem Sprung.
Brönner hat in seinem Spiel diesen brüchigen Sound, diese fast gehauchten Töne, die immer eine melancholische Grundstimmung zu haben scheinen, wäre nicht auch gleichzeitig diese Unbekümmertheit und Unschuld im Ausdruck. Ein Sound, der süchtig machen kann. „Du hast einen Ton wie eine Madonna“, soll sein alter Trompetenlehrer zu ihm gesagt haben. Nicht wenige sehen in seinem Stil deshalb auch eine Nähe zu Chet „Angelface“ Baker, dem Trompeter, der in den fünfziger Jahren zeitweise sogar Miles Davis in den Schatten stellte. Der von Frauen umschwärmte Beau, der dann durch seine Drogensucht so furchtbar abstürzte.
William Claxton hat Baker einen wunderschönen Fotoband gewidmet mit Bildern aus Bakers Erfolgsjahren 1952 bis 1957. Und Brönner widmete ihm ebenfalls ein Album, das er „Chattin With Chet“ nannte. Sogar das Cover scheint einer berühmten Aufnahme Bakers mit seiner Freundin Helima nachempfunden. Der Umschlag seiner kürzlich erschienen Autobiografie, ein Selbstporträt Brönners, erinnert stark an die Fotos, die Claxton 1955 im Studio von dem in sich versunkenen Chet Baker gemacht hat. Auch Baker hat gesungen. Wunderschön. Doch der entscheidende Unterschied zu Brönner ist die Einsamkeit, eine unerklärliche Trauer, die in jedem Ton liegt. Er sang, wie er seine Trompete spielte. Ein schwereloser Ton, der noch nachklang, auch wenn man ihn schon nicht mehr hörte.
Till Brönner ist ein Typ der Widersprüche. Er hat eine zurückhaltende und schüchterne, aber auch eine inszenierte und selbstbewusste Seite. Da ist der Musiker, der mit der Rebellion im Rock und im Jazz überhaupt nichts anzufangen weiß, aber ein glühender Verehrer von Charlie Parker und Miles Davis ist. Einmal, als er Klaus Hoffmann zu Gast bei seiner Reihe „Talkin‘ Jazz“ in der Bundeskunsthalle hatte, gab er zu, froh zu sein, sich auf der Bühne hinter seiner Trompete verstecken zu können. Andererseits sei der Trompeter derjenige in der Truppe, der den ganzen Stil der Band definiert: „Er war geradezu naturgemäß der Chef“, heißt es in seinem Buch. Er gibt nicht viel von seinem privaten Leben preis, nichts von dem, was ihn berührt, ärgert oder innerlich beschäftigt. Gut.
Die Jazz-Puristen, Musikkritiker und Jazz-Festivals sind ihm zuwider. Bei einem Konzert des amerikanischen Jazz-Trompeters Wynton Marsalis hat er „geheult vor Glück“. Und als Jugendlicher war er ein Außenseiter, weil er auf Glenn Miller stand, während andere Led Zeppelin, U2 und Pet Shop Boys hörten: „Das war Musik, die verstand ich nicht“, erzählt er. Und: „Die gute, ehrliche Rockmusik, das war erst recht nichts für mich.“
So etwas hätte auch Brönners großes Vorbild Wynton Marsalis sagen können. Doch im Gegensatz zu Brönner strotzt dieser geradezu vor Selbstbewusstsein. Das zeigt sich in seinem Spiel, in seinem ganzen Auftreten. Das Instrument selbst verleihe dem Spieler eine selbstverständliche Durchsetzungskraft, weil es von Natur her schon so laut sei, erklärte Marsalis in seinem Buch „Sweet Swing Blues“.
Zum guten Spielen, behauptet Marsalis, gehöre „Eleganz, Stil, Raffinesse und Kontrolle“ – und „gute Manieren“. Brönner scheint sich dies zu eigen gemacht zu haben. Das ist es, wonach er strebt.
Doch Marsalis sieht sich nicht nur als Gralshüter des Jazz, er gilt als Guru unter den jungen Jazz-Trompetern. Denn er sagt Dinge wie: „Du beherrschst den Wind, beförderst die Luft durch das Horn wie einen Blitz von der Hand des Zeus. Elementare Kraft, gezähmt und aus dem tiefsten Inneren nach außen geleitet. Der Klang peitscht hinaus an die Luft. Er erregt und hinterlässt ein heißes Glühen. Dann musst du dich ausruhen und zuhören.“ Solche Sätze wird man von Brönner nicht hören. Wenn er übers Trompete spielen spricht, kommt viel Theorie, viel über Technik und die Physik des Luftstroms.
Dennoch: Brönner will über seine Musik verstanden werden, auch über die Musik, die er liebt. Freddie Hubbards „First Light“, John Coltranes „A Love Supreme“, Miles Davis‘ „Kind of Blue“, natürlich „Chet Baker Sings And Plays“, Louis Armstrong, Shirley Horn, Frank Sinatra. Klar, seien es auch die „Posen, Inszenierungen. Aber ich fürchte ja: Die Posen, das bin ich schon auch.“ Andererseits sei es wichtig, dass der Zuhörer weiß, wer da spielt. „Dass da eine Kontur sichtbar wird, ein Profil, eine Persönlichkeit“, so Brönner.
Das ist vielleicht der Augenblick, an dem Brönner ganz er selbst ist. Ehrlich. Denn seine Konzerte unterscheiden sich doch von dem, was er auf seinen Alben verkauft. Da steht der Jazz eindeutig im Vordergrund. Und die Bühne ist sein Forum, wo er überraschen kann, wo er etwas von sich preisgibt. Brönner erzählt nicht gern von sich. Dafür hat er sein Instrument: „Das Wichtigste, was ich zu sagen habe“, schreibt er, „sage ich mit meiner Trompete.“